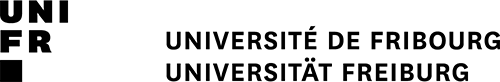27.04.2005
Zehn Jahre Institut für Europarecht
Das Institut für Europarecht der Universität Freiburg feiert Geburtstag. Prof. Astrid Epiney, geschäftsführende Direktorin seit der ersten Stunde, über ein Institut in Festlaune, juristische Knochenarbeit abseits von politischem Klamauk und die (Zwangs-)Heirat von schweizerischem und EU-Recht.
Vor just zehn Jahren wurde das Institut für Europarecht aus der Taufe gehoben. Wie wird Geburtstag gefeiert? Für den Festvortrag suchten wir eine Person, die die Entwicklung der Europäischen Union aus einem weiten Winkel, über das rechtliche Gebiet und den Fokus Schweiz hinaus, analysiert: Dr. Wolfgang Schäuble wird die Entwicklungsperspektiven der EU am 28. April skizzieren. Die wissenschaftliche Tagung tags darauf greift mit der Frage nach der Beeinflussung des Schweizer Rechts durch EU-Recht ein seit Jahren aktuelles Thema auf. Ist Wolfgang Schäuble, Jurist und Politiker in Personalunion, lebendiges Zeugnis dafür, dass Recht und Politik wie siamesische Zwillinge quasi schicksalgegeben miteinander verquickt sind? Das ist schwierig zu beantworten. Die Umsetzung des Europarechts ist im Hinblick auf eine Integration natürlich immens wichtig. Viele Prozesse spielen sich aber auch fernab der Politik ab, rein auf der Ebene des Rechts. Dies wird in der Öffentlichkeit nur schwach wahrgenommen. So ist zum Beispiel wenig bekannt, dass in weiten Bereichen des Ausländerrechts in der Schweiz europäisches Unionsrecht zur Anwendung gelangt. Ist die Tätigkeit des Freiburger Instituts hauptsächlich eine Arbeit hinter den Kulissen - nach dem politischen Paukenschlag? Nicht nur, unsere Projekte sind häufig auch vorbereitender Art. Das Institut hat zahlreiche Untersuchungen gemacht über Auswirkungen eines allfälligen EU-Beitritts der Schweiz. Solche Analysen sind die Grundlagen politischer Entscheidungen. Das Recht beschränkt sich keinesfalls darauf, politischen Entscheiden hinterherzuhinken. Ein rein ausführendes Recht, das sich den Problemen nicht stellt, wäre meines Erachtens fatal. Blicken wir auf die letzten zehn Jahre in der Geschichte des Instituts zurück: Welches sind die grossen Pflöcke, die eingeschlagen wurden? Sicher haben die Bilateralen I und II unsere Arbeit stark bestimmt. Aber es gab auch unscheinbarere Dossiers, etwa die so genannten autonomen Nachvollzüge, bei denen die Schweiz Anpassungen an das EU-Recht vornimmt, ohne dass sie dazu gezwungen wäre. So geschehen etwas beim Pauschalreisen-Gesetz, das die Rechte von Personen, die Pauschalreisen gebucht haben, im Falle eines Konkurses des Anbieters festlegt. Auch im Privatrecht, das man häufig nicht mit Europarecht in Verbindung bringt, erfolgten in den letzten Jahren zahlreiche Anpassungen an das Gemeinschaftsrecht. Was Gutachten anbelangt, hat das Institut in den letzten fünf Jahren rund 15 grössere Aufträge für Dritte erledigt. Kann man überhaupt noch von einem eigenständigen Recht in der Schweiz sprechen? Die Schweiz kann sich den Einflüssen des EU-Rechts praktisch nicht entziehen, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Denken wir nur an die Exportindustrie. Auch wenn keine politische Verpflichtung dazu besteht, macht es häufig Sinn, wenn sich das nationale Recht parallel zum Gemeinschaftsrecht entwickelt. Diese Entwicklung entspricht der bundesrätlichen Politik seit der Ablehnung des EWR. Stichwort Bilaterale Abkommen: Inwiefern war Ihr Institut diesbezüglich involviert? Unser Team hat diverse Gutachten für öffentliche Stellen erstellt, Vorträge gehalten, Publikationen verfasst und Weiterbildungen initiiert. Für Liechtenstein haben wir im Zusammenhang mit den Bilateralen II abgeklärt, welche Konsequenzen das Schengen-Dublin-Abkommen für das Fürstentum hätte. Seit 2001 wird das Institut als gemeinsame Einrichtung von den Universitäten Freiburg, Bern und Neuenburg geführt – was hat dieser Zusammenschluss gebracht? Es ist uns mit dem BENEFRI-Institut gelungen, an den drei Universitäten komplementäre Schwerpunkte zu errichten - mit Europarecht in Freiburg, Welthandelsrecht in Bern und Gesundheitsrecht in Neuenburg. Schliesslich macht es keinen Sinn, im Umkreis von 20 km Entfernungen drei Universitäten mit ein und demselben Angebot zu unterhalten. Freiburg ist mit einem Europarechtsinstitut in der Schweiz nicht allein auf weiter Flur. Was hebt Sie von den anderen Angeboten ab? In Freiburg beschäftigen uns vor allem institutionelle Fragen sowie mit einigen spezifischen Politiken (wie etwa Umweltrecht oder freier Personenverkehr) und dem europäischen Privatrecht; Schwerpunkte, die anderswo so nicht vorhanden sind. So wurde eine Studie über die Auswirkungen eines EU-Beitritts auf die direkte Demokratie in der Schweiz erstellt oder etwa die europarechtlichen Vorgaben für die Anerkennung von Diplomen für Medizinalpersonen geprüft, die mit dem Freien Personenverkehr zum Tragen kommen. Weiter beginnt man in der europarechtlichen Lehre in Freiburg insgesamt doch einiges früher als an vielen anderen Fakultäten. Welchen grossen Herausforderungen hat sich das Institut in den nächsten Jahren zu stellen? Unsere finanzielle Basis ist nur noch bis 2007 gesichert, dann läuft der Kredit des Staatssekretariats für Bildung und Forschung aus. Die Drittmittel sind in der Regel gebunden für Gutachten oder Projekte. Was die Stellen anbelangt, wird es jedoch eng, es gilt, neue Quellen zu erschliessen, insbesondere, soweit die sehr präsenten Leistungen des Instituts für die Ausbildung im Europarecht in der Grundausbildung betroffen sind. Inhaltlich werden uns die Bilateralen II auf Trab halten. Und was das Lehrangebot anbelangt, soll die BENEFRI-Zusammenarbeit noch intensiviert werden. Insbesondere die Möglichkeiten eines gemeinsamen Masters werden in den kommenden Monaten geprüft. Fotos: http://www.unifr.ch/spc/alb/thumbnails.php?album=26