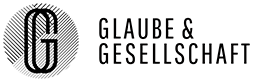Wochenprogramm
Thema 5 – Gebet und Einheit

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.
Bruder Klaus

Blog-Artikel
Als gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts ein ökumenisches Bewusstsein erwachte, schlugen engagierte Anglikaner und Katholiken vor, in den neun Tagen zwischen Auffahrt und Pfingsten für die Einheit der Kirche zu beten. Manche Leseordnungen sehen für diese Tage das Gebet Jesu aus Johannes 17 vor, wo er selbst darum bittet, „dass alle eins sind“. An Pfingsten hat die Kirche Geburtstag. Dass das Thema „Gebet und Einheit“ der Studientage in pfingstliche Zeit fällt, mag ein Zufall sein. Aber wer weiß, vielleicht hat es ein zum Dienst an der Einheit bestellter Engel gefügt. Die Organisatoren waren es auf jeden Fall nicht, wie mir persönlich versichert wurde. Wie dem auch sei, ich möchte zwei Gründe nennen, warum Pfingsten zum Gebet für die Einheit einlädt.
Der erste betrifft das Gebet überhaupt. Es gibt kein Beten ohne den Heiligen Geist. Wir beten, weil Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat, damit wir wie Jesus Gott voll Vertrauen „Abba“ rufen (Gal 4,6). Der Geist Christi offenbart uns Gott als den Vater, der uns wie eine Mutter tröstet. Der Heilige Geist bewegt auch zur Klage. Ohne den Geist der Wahrheit hätte Hiob nicht durchgehalten. Dass „die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag“ (Röm 8,22), bewirkt ebenso der Heilige Geist. Papst Johannes-Paul II, der am 18. Mai hundert Jahre alt geworden wäre, sagte: „Wo immer man in der Welt betet, ist der Heilige Geist, der belebende Atem des Gebetes, gegenwärtig.“
Von einem zweiten Grund, weshalb es für unser Thema keine passendere Zeit als Pfingsten gibt, handelt die Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte. Nach Ostern erwarteten die Apostel in Jerusalem das Reich Gottes, sein mächtiges Kommen als König. Sie hofften auch, dass sich der auferstandene Messias auf den Thron seines Vaters David, und sie selbst sich auf die zwölf Throne, die er ihnen verheißen hatte, setzen würden. So etwas hätte ganz Israel bekehrt. Was aber die Leute zu sehen und hören bekamen, war nicht grandios. Viele spotteten über die einhundertzwanzig Gläubigen, die in einer Begeisterung, die an Trunkenheit erinnern mochte, Gottesdienst feierten. Aber einige staunten auch: sie hörten Worte, die sie verstehen konnten. An Pfingsten konnte niemand alles, aber alle etwas verstehen.
Pfingsten zeigt, was geschehen kann, wenn Menschen beten. Sie können die Kontrolle verlieren, wenn der Heilige Geist sie erfüllt. Der Geist Jesu nimmt uns selbst und macht uns Jesus zu eigen. Das geschah auf sichtbare Weise an Pfingsten in Jerusalem. Darum bat Bruder Klaus in Verborgenheit und Stille: „Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.“ Beim Beten macht der Heilige Geist uns dazu bereit, in der Nachfolge Jesu auf Eigeninteressen und Herrschaftsansprüche zu verzichten. Gemeinschaft wächst, wo wie an Pfingsten niemand alles, aber alle etwas können.

Frère Richard (Bruder der Communaute de Taizé)
-
"An Ecumenism of Repentance" / "Eine Ökumene der Busse" mit Peter Bouteneff (e/d)
Maximus the Confessor (7th c.) was one of the greatest theologians of the Church. He knew well the complexities of theology, and how theological differences could divide the Church. Yet when he was asked why there are church divisions, he said that they all result from a lack of love. Might our efforts at church unity be deepened by a repentant reflection on our inner dispositions? What kinds of work do we need to do internally and spiritually in order to preserve and build church unity?
Maximus der Bekenner (7. Jh.) war einer der größten Theologen der Kirche. Er wusste um die Komplexität der Theologie und wie theologische Unterschiede die Kirche spalten können. Doch als er gefragt wurde, warum es kirchliche Spaltungen gebe, sagte er, dass sie alle aus einem Mangel an Liebe entstehen würden. Könnten unsere Bemühungen um die Einheit der Kirche durch eine bußfertige Betrachtung unserer inneren Dispositionen vertieft werden? Welche innerliche und geistliche Arbeit ist noch zu bewältigen, damit die Einheit der Kirche bewahrt und aufgebaut wird?

Peter Bouteneff is Professor of Systematic Theology at St. Vladimir's Orthodox Seminary. He originally received his doctorate from the University of Oxford and is now the director of the SVS Sacred Arts Initiative at St. Vladimir's Seminary, where he is deeply involved with the music of Arvo Pärt. For several years, Bouteneff was Executive Secretary for Faith and Order of the World Council of Churches and was strongly committed to theological dialogue.
Peter Bouteneff ist Professor für Systematische Theologie am St Vladimir’s Orthodox Seminary. Er hat ursprünglich an der University of Oxford promoviert und ist heute Direktor des SVS Sacred Arts Initiative am St Vladimir’s Seminary und setzt sich intensiv mit der Musik von Arvo Pärt auseinander. Während mehreren Jahren war Bouteneff Executive Secretary for Faith and Order des Ökumenischen Rats der Kirchen und sich in dieser Funktion stark für den theologischen Dialog eingesetzt.
-
Gebet und Ökumene als "Verlustgeschäft" mit Frère Richard
Wer betet, verliert etwas, Zeit auf jeden Fall, vielleicht noch mehr. „Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir“: im Gebet verlor Niklaus von Flüe sich selbst an Gott. Auch Ökumene, sagte Papst Franzikus 2018 in Genf, ist „ein grosses Verlustgeschäft“. Er zitierte Jesus: „Wer sein Leben um meintewillen verliert, wird es finden.“ Was folgt aus diesem Jesuswort für das Gebet und für die Ökumene?

Frère Richard geboren in Bargen (bei Aarberg), besuchte das klassische Gymnasium in Langenthal. Nach der Matura lebte er ein Jahr als Freiwilliger in Taizé und trat 1979 in die Communauté ein. Er hilft bei der Gestaltung der Jugendtreffen mit, ist an der theologischen Arbeit der Communauté und der Ausbildung der jüngeren Brüder beteiligt und pflegt für die Communauté Kontakte insbesondere mit Südosteuropa.
-
"Together on the Mountain: Unity and Spirituality" / "Gemeinsam auf dem Berg – Einheit und Spiritualität" mit Hans Boersma (e/d)
Modernity has replaced the interconnected, sacramental universe of the Great Tradition with an atomistic understanding of reality. In philosophical terms, we have moved away from realism toward nominalism. This talk sketches this development and draws out its spiritual implications. Saint Anselm’s Proslogion intimates what it means if we make the end (the vision of God) the starting point for our spirituality.
Was ist aus dem ökumenischen Dialog geworden? Wo ist der Optimismus, der diese Bewegung am Anfang prägte? Ist das Dogma letztendlich ein Hindernis für die Einheit? Für die Kirchenväter wird die christliche Glaubenswahrheit auf dem Gipfel des Berges erkannt. Indem die Kirchenväter Theologie und den Aufstieg zu Gott verbinden, lehren sie, dass das Geschenk der Einheit nur zugänglich wird, wenn wir theologische Dialoge betend, in der Gegenwart des verklärten Christus, führen.

Hans Boersma has been professor at the Nashotah House Theological Seminary in Wisconsin (USA) since 2019. Prior to that he was professor at Regent College in Vancouver for fourteen years and at Trinity Western University in Langley for six years. Boersma is known for his books, including Seeing God: The Beatific Vision in Christian Tradition (2018), Scripture as Real Presence (2017), and Heavenly Participation (2011). His research focuses on Catholic thought, the Fathers of the Church and the spiritual interpretation of Scripture.
Hans Boersma ist seit 2019 als Professor am theologischen Seminar Nashotah House in Wisconsin (USA) tätig. Davor war er während vierzehn Jahren Professor am Regent College in Vancouver sowie für sechs Jahre an der Trinity Western University in Langley. Bekannt ist Boersma u.a. für seine Bücher, darunter Seeing God: The Beatific Vision in Christian Tradition (2018), Scripture as Real Presence (2017) und Heavenly Participation (2011). Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören das katholische Denken, die Kirchenväter sowie die geistliche Interpretation der Schrift.
-
"Gebet als Busse: von der Notwendigkeit, sich immer wieder Gott zuzuwenden" mit Luca Baschera
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gebet und Busse und wenn ja, worin besteht er? Und was ist "Busse" überhaupt? Diese und andere Fragen werden in exegetischer, historischer und liturgischer Hinsicht angesprochen.

Luca Baschera, * 1980; Dr. phil., VDM, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich, Privatdozent für Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich und Beauftragter für Theologie bei der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS). Er ist Mitglied im Schweizer Konvent der Evangelischen Michaelsbruderschaft.