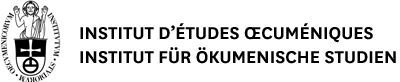Erster Teil: Wovon man selten spricht
Vom Sterben
Der russische Dichter und Nobelpreisträger Iwan Bunin schrieb die Novelle "Der Herr aus San Francisco". Danach fuhr ein reicher Mann nach Europa, um sich in den berühmten Städten der Alten Welt zu zerstreuen. Auf dem Luxusdampfer "Atlantis" freute sich eine elegante Gesellschaft an auserlesenen Speisen und tanzte vergnügt zu einer wollüstig-schamlosen Musik. In Neapel angekommen, begab sich der Mann aus San Francisco tags darauf wegen schlechten Wetters auf die Insel Capri. Nachdem er sich im Hotel für das Abendessen sorgfältig umgekleidet hatte, ging er zunächst in den Leseraum. Während er in einer Zeitung blätterte, riss es ihn plötzlich vornüber: Er glitt zu Boden und begann zu röcheln. Er "rang hartnäckig mit dem Tode, wollte sich ihm auf keinen Fall ergeben, ihm, der so unerwartet und roh über ihn hergefallen war".[1] Die Dienerschaft trug ihn schnell in ein verlassenes Zimmer, in dem jedoch bald sein Tod eintrat. Wegen des erschreckenden Vorfalls entstand unter den zum Abendessen herbeirauschenden Damen eine allgemeine Verwirrung, die der Hotelier mit höflichen Worten zu beschwichtigen suchte. Am frühen Morgen wurde der Leichnam in eine Kiste verpackt und unbemerkt nach Neapel gebracht, von wo aus man ihn auf demselben Dampfer "Atlantis" nach San Francisco zurückschaffte. Man verbarg ihn diesmal im untersten Schiffsraum, damit keinem der Fahrgäste die gute Laune verdorben würde.
Die kurze Novelle ist von seelischer Grausamkeit und hat symptomatische Bedeutung. Dies nicht nur wegen des vom Dichter vorangesetzten Mottos aus der Offenbarung Johannis: "Weh, weh, die große Stadt Babylon, die starke Stadt". Auffallenderweise wird der Name des Herrn aus San Francisco nie genannt. Warum nicht? Offensichtlich ist mit der Erzählung jedermann angesprochen. Ebenso bezeichnend ist das schockierte Verhalten der Gäste und des Hotelpersonals, die sich über den störenden Todesfall möglichst schnell hinwegsetzen. Alle "Menschen wundern sich auch heute noch am meisten über, den Tod, und um nichts auf der Welt wollen sie an ihn glauben", schreibt der Dichter.[2]Bunins unumstrittene Meisternovelle spricht für sich selbst und bedarf in ihrer Dichte und Härte keiner rühmenden Empfehlung. Ohne lehrhaft zu werden, zeigt sie die stete Gegenwart des Todes als eine der sichersten Realitäten.
Die Menschen von heute sind redselig. Es wird gegenwärtig viel, allzu viel geredet. Zu Hause, in den Wirtschaften, den Schulen, den Parlamenten, in den Parteien und im Radio, kurz, überall wird geredet und geredet. Diskussion - beschönigenderweise sagt man heute oft "Dialog" - ist zu einem Lieblingswort unserer Zeit geworden. Über alles will man disputieren, auch wenn man über das Thema selbst noch nie nachgedacht hat. Die Hauptsache ist, dass die Diskussion in Fluss kommt. Die intimsten Angelegenheiten sind zum Gesprächsstoff geworden, und Nichtigkeiten werden zu Podiumsgesprächen aufgebauscht. Auch ernste Dinge werden so lange zerredet, bis nur noch ein fader Geschmack auf der Zunge übrigbleibt. Alles droht im Geschwätz unterzugehen. Die Massen fallen ohnehin auf Demagogen und Schönredner herein; man meint, wer das beste Mundstück hat, sei der Mann des Tages. Muss und kann sich wirklich eine Seelennot im vielen Reden Luft machen? Oder ist eine Krankheit wie eine Epidemie über die Welt hereingebrochen?
Wäre es nicht angebrachter, beharrlich zu schweigen? Vielleicht würde dies sich indirekt nachhaltiger auswirken. Nach dem oft genannten, aber wenig wirklich gelesenen Sören Kierkegaard fehlt unserer Zeit das Schweigen. Dreimal setzte er das Wort ‚Schweigen' hintereinander, um ihm mehr Nachdruck zu verschaffen Dann stellte der Däne seine unzeitgemäße Forderung ganz radikal auf: "Schaffe Schweigen!"3 Eine verwirrte Christenheit hat Kierkegaard überhört, aber sie wird noch einmal auf ihn zurückkommen.
Wenn schon geredet werden soll, dann darf man nicht die modischen Schlagworte aufgreifen, sondern muss die umgangenen Fragen, die Existenzprobleme des Menschen erörtern. Das Unausgesprochene ist vor allem besprechenswert. Es ist durchaus zweitrangig, ob sich nun viele oder wenige an der einsamen Zwiesprache beteiligen; wichtig allein sind die lebensinhaltlichen Fragen. Es gibt einige ernste Probleme, die bei der ungezügelten Redseligkeit meistens ausgeklammert bleiben. Wovon alle reden, ist unwichtig - wovon niemand zu sprechen wagt, hat Gewicht. Wenn die Massen brüllen, muss man schweigen - wenn der Menge der Atem ausgeht, dann ist es an der Zeit, auf die letzten Wahrheiten hinzuweisen.
Zu den unterdrückten und selten erörterten Fragen gehört das menschliche Sterben. Die Seltenheit der Todesgespräche ist nicht nur zu bedauern, denn darin kommt auch ein Gefühl für die Erhabenheit dieses Themas zum Vorschein. Durch ein allzu häufiges Hören büßt auch die schönste Musik ihren Klang ein. Das Seltene muss Seltenheitswert behalten. Mag man auch nur bei außerordentlichen Gelegenheiten offen über das Sterben sprechen, so wohnt doch in jedem Menschen ein inneres Wissen um das, worüber man nicht gerne oder nur in Ausnahmesituationen redet.
Alle wissen, dass der Mensch von der ersten Stunde seines Lebens an unablässig dem Tode entgegenschreitet. Keiner wird übersehen und vergessen. Mag ein Mensch noch so steinalt werden, mögen alle seine Altersgenossen schon längst ins Grab gesunken sein, in einer bestimmten Stunde kommt auch er unweigerlich an die Reihe. Auch Staatsmänner, die sich so selbstherrlich gebärden, als würden sie die Weltgeschichte gestalten, müssen früher oder später, rühmlich oder unrühmlich, von der Lebensbühne abtreten. Das Lied von Notker aus dem neunten Jahrhundert, "mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen", gilt immer noch.4 Am hellen Tag schließt der Knochenmann den Menschen unerwartet in seine Arme, ein Bild, das Käthe Kollwitz gezeichnet und mit dem einen Wort "Tod" umschrieben hat.5 Zu diesem Thema zeichnete sie eine ganze Bildfolge: "Frau reicht dem Tod die Hand", wozu auch die ergreifende Zeichnung "Tod greift in eine Kinderschar" gehört. Sogar ein Selbstbildnis befindet sich darunter: Eine fremde Hand tippt der Künstlerin auf die Schulter. Käthe Kollwitz lebte im Berliner Armenviertel. Gerade inmitten des großstädtischen Wirbels vernahm die unbestechliche Frau das leise geflüsterte, aber unüberhörbare "Memento mori!". Die Stunde, da der Tod zu einem Menschen sagt: "Komm, deine Zeit ist abgelaufen", tritt an jeden heran. Alle, ohne Ausnahme, werden vom Mahlstrom des Todes verschlungen. Das ist in den vielen Ungewissheiten des Lebens eine der ganz wenigen Gewissheiten.
Diese Erfahrung wird niemand bestreiten, merkwürdigerweise aber macht sie keinen sonderlichen Eindruck. Es ist ein Wissen ohne Wirkung. Der Mensch weiß es und weiß es doch nicht, jedenfalls benimmt er sich so, als ginge ihn persönlich diese Wahrheit nichts an oder als liege sie in weiter, weiter Ferne. Viele Menschen denken: Ja, der Tod kommt einmal, aber dies hat noch Zeit, jedenfalls ist jetzt diese Frage noch nicht akut. Warum verhält man sich so? Lebt es sich leichter, wenn man das Unabänderliche von sich schiebt? Ist das nicht eine Selbsttäuschung?
Das ändert sich freilich oft mit einem Schlag, wenn der Mensch von einer Krankheit betroffen wird und der Arzt ihm sagt: "Ihre Lebenszeit ist begrenzt; sie dauert höchstens noch zwei bis drei Monate, und dann tritt das Unvermeidliche ein." Wenn der Tod dermaßen direkt auf einen Menschen zukommt, dann verändert sich die ganze Situation total. Muss man erbleichen vor dem furchtbaren Ernst der neuen Lage? Nicht unbedingt. Doch das Nicht-sehen-Wollen ist vorbei, und alle Dinge nehmen schärfere Konturen an. Man betrachtet das Leben vom Tode her, und plötzlich scheinen Geld, Erfolg und Karriere ganz unwichtig zu sein. Die unmittelbaren "Offenbarungen des Todes", wie der russische Religionsphilosoph Leo Schestow formuliert, "sind von einzigartiger Gewalt: Der Rachen des Todes hat sich geöffnet." Ungeachtet der gewandelten Situation bleibt zweierlei immer noch ungewiss: Der genaue Zeitpunkt und die Art und Weise, wie es geschieht. Vielleicht diese Nacht? Ist mir noch eine kurze Zeit vergönnt, oder nimmt mir der Tod die Feder aus der Hand, bevor ich diese Arbeit zu Ende geschrieben habe? Dies entzieht sich menschlicher Voraussicht. Ebensowenig weiß man, wie der lautlose Vorgang geschieht, ob unerwartet das Herz stillesteht, oder ob man eine lange und qualvolle Leidenszeit durchmachen muss. Erleidet der Mensch einen plötzlichen Unfalltod mitten auf einer belebten Straße, umgeben von einer gaffenden Menschenmenge - und dies in einem Augenblick, da er an alles andere dachte, nur nicht an den eigenen Tod? Jedenfalls vollzieht sich die Todesstunde anders, als man sie sich vorstellt. Die Ungewissheit in der Gewissheit bleibt bestehen - eine überaus erregende Einsicht. Es ist wie bei den Gottesbeweisen: Wären sie stringent, gäbe es kein Wagnis des Glaubens, wäre das Leben unbefristet, würde die Endlosigkeit langweilig sein.
Trotz aller dieser unbestreitbaren Wahrheiten bleibt das Thema des Sterbens gewöhnlich unerörtert. Auf die Frage, warum so viele Menschen dem Todesproblem ausweichen, gibt das Märchen "Der Gevatter Tod" aus der Sammlung der Brüder Grimm eine nachdenkenswerte Antwort.6
Danach erhält ein armer Knabe den dünnbeinigen Tod zum Gevatter, womit die nahe Beziehung der beiden Beteiligten angedeutet ist. Der Tod läßt sein Patenkind Arzt werden und verleiht ihm als Geschenk die Gabe: "Wenn ich zu Häupten eines Kranken stehe, so kannst du keck versprechen, du wolltest ihn wieder gesund machen; stehe ich aber zu Füßen des Kranken, so musst du ihm sagen, kein Arzt der Welt könne ihn noch retten." Bald darauf wurde der König krank, und der Tod stand zu Füßen des Patienten. Der Arzt dachte bei sich: "Wenn ich doch einmal den Tod überlisten könnte!" und drehte kurzerhand den Kranken um, worauf der Tod zu Häupten des Königs stand. Der Tod machte ein finsteres Gesicht, drohte mit dem Finger und sagte zum Arzt: "Du hast mich hinter das Licht geführt; weil du mein Patenkind bist, will ich es für diesmal nachsehen." Der Arzt versuchte es jedoch ein zweitesmal, aber da fuhr der Tod ihn an: "Es ist aus mit dir, und die Reihe kommt nun an dich", packte ihn mit seiner eiskalten Hand und führte ihn ab.
Welch tiefsinnige Weisheit enthalten doch die Märchen! Sie sind weit mehr als bloße Kinderunterhaltungen. Zwar hat sich die Tiefenpsychologie der Märchen bemächtigt, beutet sie jedoch nur für ihre Theorien aus. Es ist durchaus sinnvoll, über die fromme und schreckliche Märchenwelt unvoreingenommen nachzudenken, denn viele Märchen enthalten einen brauchbaren Schlüssel zum Verständnis des Lebens. Jedenfalls kann man auf ihr symbolisches Denken nicht verzichten. Das Märchen "Der Gevatter Tod" zeigt überaus anschaulich, dass der Mensch immer wieder versucht, den Tod zu überlisten, und dass ihm das bei aller Schlauheit doch nicht gelingt. Der Tod steckt zuletzt auch den listenreichsten Menschen kaltblütig in die Tasche.
Trotz des Todes drohendem Finger versucht auch der heutige Mensch, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Sein Überlistungsversuch ist anderer Art, besteht aber doch auch in einer merkwürdigen Umdrehung, indem er sich bemüht, den Tod zu ignorieren. Der Kranke wird nicht mehr umgedreht wie im Märchen, aber man verlegt sein Sterben aus der vertrauten Häuslichkeit in das Spital, wo er in einem Abstellraum seine Seele aushaucht. Das Sterben soll nach Möglichkeit heimlich und unbemerkt vor sich gehen. Zwar erscheinen noch täglich schwarzumrandete Todesanzeigen in den Zeitungen, doch hat man meistens die Menschen nicht gekannt und blättert deshalb seelenruhig weiter. Langsam fahrende Leichenwagen sind aus dem modernen Straßenbild verschwunden, angeblich des Verkehrs wegen, in Wirklichkeit aber will der heutige Mensch durch kein Leichenbegängnis an den Tod erinnert werden. Immer mehr findet die Abdankung im allerengsten Familienkreis statt, und seit dem Zweiten Weltkrieg verzichten die Angehörigen darauf, nach einem Todesfall noch länger schwarze Trauerkleidung zu tragen. Gewiss trauern auch in der Gegenwart die Menschen über den Verlust eines geliebten Angehörigen, aber man soll den Schmerz für sich behalten, weil er die andern stört. Man glaubt, es sei besser, sich so schnell wie möglich wieder dem pulsierenden Leben zuzuwenden, das so viel verspricht und so wenig hält. In der modernen Zeit bemüht man sich mit allen Mitteln, den Tod einfach aus dem Bereich des Denkens auszuschalten. Man will nicht daran erinnert werden. In diesem Verhalten zeigt sich der heutige Versuch einer Überlistung des Gevatters Tod; er soll in den Untergrund verdrängt werden. Der Tod hat im wissenschaftlich-technischen Zeitalter keinen Platz mehr. Nach Aris ist der Tod "ähnlich tabuisiert worden wie in der viktorianischen Epoche die Sexualität, deren Nachfolge er übernommen hat: Ein Tabu ist an die Stelle eines andern getreten".7
Die Verbannung des Todes aus dem Alltagsleben ist eine törichte Selbsttäuschung. All die erwähnten Versuche sind ein vergebliches Unterfangen. Bleibt dem Tod die Eingangstüre verschlossen, steigt er durch eine Hintertüre herein. Es ist ganz unmöglich, ihn wie einen unbequemen Dissidenten auszubürgern. Der Sensenmann behält auch in der modernen Zeit das letzte Wort. Man mag ihm den Rücken zukehren, aber nichtsdestoweniger ist er da. Das lässt sich gar nicht bestreiten. Die Flucht vor dem Tod ist sinnlos. Man entrinnt ihm nicht, selbst wenn man nach so gierig den vielen modischen Dingen nachjagt. Früher oder später wird der Mensch von seiner kalten Hand gepackt. Und wenn Lenin erklärte: "Der Tod ist ein Schacht, in den der Unrat geworfen wird"8, so verrät diese Aussage die primitive Denkweise des Marxismus, bei dem alle seelischen und metaphysischen Fragen ausgeklammert und als bürgerliche Dekadenz abgetan sind.
Anstatt arrogant von der "Banalität des Todes" zu reden, geht es darum, dem Tod seine Würde zurückzugeben, auf die er Anspruch hat. Er ist und bleibt ein entscheidendes Geschehen. Es bedarf eines auf den Grund gehenden Umdenkens, um die heutige Oberflächlichkeit durch ein tieferes Todesverständnis zu ersetzen.
Bei dieser neuen Aufgabe sind vorerst die mannigfachen Bemühungen auszuräumen, die den Tod anschwärzen oder verharmlosen wollen.
Es ist unstatthaft, mit der düsteren Unfassbarkeit des Todes dem Menschen Angst einzujagen. Es ist ein krasser Missbrauch der Kanzel, wenn übereifrige Prediger verkündigen: "Oh, die Größe, die Heftigkeit, die Mannigfaltigkeit der Qualen der Hölle erfüllt unser Herz mit Schrecken; aber die ewige Dauer verwirrt alle meine Begriffe; es durchrieselt mich kalt; ich vermag kaum mehr zu sprechen".9 Diese bloß schlechte Rhetorik entspricht einer pervertierten Religiosität. Der Mensch hat ohnehin genug mit der Angst zu kämpfen; man müsste doch mit aller Kraft versuchen, ihn von ihr zu befreien.
Ebenso falsche Todesgespräche werden in den Niederungen des Okkultismus geführt. Zwar redet man über okkulte Phänomene um so lieber, je mehr es sich um dubiose Angelegenheiten handelt. Spiritistische Unterhaltungen mit Verstorbenen sind abergläubische Machenschaften, an denen sich religiöse Menschen nicht beteiligen. Der Okkultismus wird nicht besser, wenn sich die Parapsychologie seiner annimmt, die ohnehin nicht über die allerersten Anfänge hinausgelangt ist. Noch heute, wie vor fünfzig Jahren, kann sie nur unerklärliche Vorkommnisse registrieren, vermag sie jedoch nicht zu deuten, und trotzdem zieht sie sensationslüsterne Menschen mächtig an.
Schließlich ist auch der Versuch töricht, den Tod mit allerlei neuromantischen Ideen zu verbrämen. Nietzsche forderte seine Leser auf, "aus dem Tode ein Fest zu machen"10, was ihm selbst nach der jahrelangen Umnachtung nicht möglich war. Die sich als unverstandene Frau fühlende Hedda Gabler will "mit Weinlaub im Haar in Schönheit sterben"11, aber Ibsen lässt sie in Selbsttötung enden. Rilke dichtete im "Stundenbuch" die Verse:
"O Herr, gib jedem seinen eignen Tod,
das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not".12
Auch in den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" erhebt Rilke die Frage: "Wer gibt heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod?"13 Die Formulierungen vom "eigenen" und "gut ausgearbeiteten" Tod wurden viel zitiert. Sie klingen auch schön und haben vielen Lesern gefallen. Begreiflicherweise, denn der Mensch liebt illusionäres Denken. Trotzdem dürfen sie nicht zum Nennwert genommen werden. Der Dichter hat Worte wie "Pilgerschaft", "Armut", "Engel" usw. dem religiösen Sprachschatz entnommen, sie sind aber, näher besehen, bei ihm gar nicht religiös gemeint. Rilke verstand sie ästhetisch. Die erwähnten Sätze helfen dem Menschen in seiner schweren Todesnot nicht, weil er meistens zu schwach ist, sie zu verarbeiten. Er muss froh sein, mit sich nur ein wenig zurechtzukommen. Es geht nicht an, das Sterben des Menschen schöngeistig zu umspielen. Der Tod darf nicht als schöne Frau betrachtet werden, wie es der russische Symbolist Fjodor Ssologub getan hat. Auch die sublimste Ästhetik hat hier keinen Platz. Der Tod zwingt zur Ehrfurcht und Ehrlichkeit Er schließt zahlreiche, unausweichliche Fragen in sich.
Das Sterben ist kein Geschehen für Zuschauer. Es kann sich nicht um ein effektvolles Bühnenstück handeln und auch nicht um ein "Interview mit Sterbenden", bei dem nach amerikanischer Manier alles, auch das Intimste, an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Interviews sind Sache der Journalisten: Sie horchen überall herum und kennen kaum eine Privatsphäre. Bloße Neugierde ist beim Sterben nicht am Platze, denn das Thema geht uns zunächst selbst an. Wir sind von ihm betroffen, denn wir werden früher oder später dem Tode gegenüberstehen. Die Aufgabe besteht darin, den Sterbenden zu begleiten, was etwas wesentlich anderes ist, als ihn bloß interessiert zu beobachten. Man muss ihm die Hand reichen, muss sich an seine Seite setzen und bis zu seinem letzten Atemzug nicht von ihm weichen. Der Sterbende hat auf innige Anteilnahme Anspruch. Es ist ein Mangel an Mut, sich aus dem Zimmer eines Sterbenden zu schleichen oder es zu einem Raum der Lüge zu machen, in dem man anders spricht als außerhalb seiner Wände. Das artige "Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach" enthält ein Sterbelied, das mit den Worten beginnt: "Bist du bei mir". Sie beziehen sich auf den Lebensgefährten, dessen Gegenwart den Sterbenden tröstet. Überträgt man die Worte auf Gott, schenken sie eine noch stärkere Geborgenheit. Sie sind dem Übernatürlichen nahe, und wer sie in der Sterbestunde mit Überzeugung wiederholt, wird diese auch bestehen.
Leopold Ziegler schrieb in einem seiner Frühwerke: "An dem Verhältnis des Menschen zum Tod, an dem Grad seiner Erschütterung, an seinem Widerstreben oder Abscheu kann man ablesen, ob er seinem Leben die rechte Richtung gegeben habe oder nicht".14 Es gilt, die rätselvolle Sprache des Todes zu hören und zu verstehen, weil man nicht bloß von der Vorderseite des Lebens Notiz nehmen darf. Wir müssen das heute selten geführte Gespräch über den Tod wiederaufnehmen und die unangenehmen Gefühle überwinden, damit man das Dasein wieder besser versteht. Es ist ein Sophismus, wenn man sich diesem Nachdenken durch den Einwand entziehen will, dass Mensch und Tod nichts miteinander zu tun hätten, denn solange der Mensch lebe, sei der Tod nicht da, und wenn der Tod das. Feld beherrsche, sei der Mensch nicht mehr da. Das tänzerische Überspielen aber wird durch jeden Todeskampf widerlegt, den Menschen manchmal tagelang zu bestehen haben. Während dieses Ringens stehen sich Mensch und Tod konkret gegenüber und haben in diesen Stunden sehr viel miteinander zu tun.
Es kommt alles darauf an, wie man vom Sterben spricht. Es kann oberflächlich und konventionell, aber auch zynisch und sentimental geschehen; in allen diesen Fällen ist der Ton verfehlt. Man muss nach einer anderen Sprache suchen, weil nur sie den Offenbarungen des Todes gerecht wird. Verbrauchte oder neue Schlagworte verblassen in kürzester Zeit. Ebensowenig darf es eine Geheimsprache für Eingeweihte sein. Schlicht und klar soll die Rede sein, damit auch der einfache Mensch sie versteht. Redlich und vor allem mit Hintergrund muss man über das gemiedene Thema sprechen, damit man den Wurzeln aller Dinge näherkommt.
"Wie sie starben", lautet die erste Hälfte unseres Untertitels. Die schwere Frage ist für alle Menschen bedeutsam, ganz gleich, ob sie religiös oder ungläubig sind. Man mag es drehen und wenden, wie man will: Der Tod gehört zum Leben, und unmöglich ist es, ihn auszumanövrieren. Auch in den kommunistischen Staaten wird gestorben, und zwar genauso schwer wie im Westen. Das Sterben kennt weder politische noch weltanschauliche Grenzen. Mag der Tod nun Künstler oder Bauern, vornehme Damen oder Fabrikarbeiterinnen anfallen: Sie alle enthüllen dabei ihr inneres Wesen, oft ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Die meisten Menschen erleben den Tod in einem bewusstlosen Zustand. Viele wollen verwirrten Geistes fliehen. Entschwindet der Sterbende immer mehr? Erreicht ihn zuletzt unsere Stimme nicht mehr? Oder klammert er sich an seine Nächsten, um eine Verbindung herzustellen, die über sein Abscheiden hinaus Bestand hat? Das Sterben ist das letzte, das der Mensch auf Erden erlebt. Er hat es schon nicht mehr völlig in der Hand. Wünschenswert ist, vorläufig gesagt, "alt und lebenssatt zu sterben", wie es die Patriarchen des Alten Bundes taten, die das Leben mit seiner List und seinem Schmerz reichlich erfahren hatten und darum die innere Bereitschaft aufbrachten, nun auch "zu den Vätern versammelt zu werden".
1 Iwan Bunin, Grammatik der Liebe, 1973, S. 246.
2 Ebd., S. 245.
3 S. Kierkegaard, Zur Selbstprüfung, 1953, S. 85.
4 Lobet den Herrn, ed. Zoosmann, 1928, S. 897.
5 G. Strauss, Käthe Kollwitz, 1950, S. 142ff.
6 Die Märchen der Gebrüder Grimm, 1924, Bd. I, S. 192.
7 Philippe Ariès, Geschichte des Todes, 1982, S. 736.
8 Tod und Sterben, ed. Pöhlmann, 1979, S. 115.
9 B. Groethuysen, Die Entstehung der bürgerlichen Weltanschauung in Frankreich, 1927, Bd. I, S. 90.
10 Nietzsches Werke, 1923, Bd. XII, S. 35.
11 Henrik Ibsen, Sämtliche Werke, ed. o.J., Bd. 5, S. 194.
12 R.M. Rilke, Das Stundenbuch, 1928, S. 86.
13 R.M. Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1928, S. 13.
14 Leopold Ziegler, Vom Tod, 1937, S. 43.