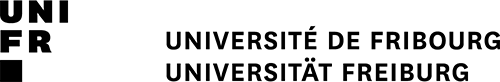Publikationsdatum 25.05.2025
Das Wort des Dekans Joachim Negel - HS 2024/III
Liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät
Liebe Freundinnen und Freunde
Manche Bilder sind so tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, daß selbst die rabiateste Säkularisierung sie nicht ausradiert bekommt. Das österliche Bild der Auferstehung gehört dazu. Man gehe nur in diesen Tagen raus an die frische Luft und man sieht, wie in der Wärme der Frühlingssonne allenthalben das Leben erwacht: Die Weinstöcke treiben aus, Anemonen und Primeln, Tulpen, Narzissen und Osterglocken gießen ihre Farben in die Beete, Kirsch- und Apfelblüten, Hyazinthen, Glyzinien und der Phlox verbreiten ihren betörenden Duft. So vergänglich das alles sein mag, so rasch die Farben des Frühlings verblühen und die Duftmarken der Blüten, kaum in die hungrige Nase gekrochen, vom Winde verweht werden, so sehr sind diese Sinnesspektakel Sinnbilder eines Lebens, das nicht totzukriegen ist. Und so erstaunt es nicht, auf Lieder und Gedichte zu stoßen, deren Autoren zwar nicht gerade dafür bekannt sind, kirchenfromm zu sein, deren Texte gleichwohl auf erstaunliche Weise österlich gestimmt sind. Zwei solcher Lieder möchte ich Ihnen, verehrte Freundinnen und Freunde, vorstellen. Das erste stammt von dem alten Erzheiden Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832); das zweite von dem Punk- und Rocksänger Rio Reiser (1950 - 1996), im deutschen Sprachraum bekannt als intellektueller Kopf der Berliner Anarcho-Band „Ton Steine Scherben“. So aggressiv die frühen Lieder von Rio Reiser auch sind („Macht kaputt, was euch kaputt macht“) und so suggestiv die pantheisierenden Jargoniaden des alternden Goethe, so mitreißend die radikale Auferstehungshymne des einen und so anrührend das Ostergedicht des anderen. Hören wir zunächst Goethe:
Osterspaziergang[1]
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche,
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungs-Glück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in raue Berge zurück.
[…]
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden,
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und aus Gewerbes Banden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern […],
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
[…]
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.
Ein Werk der leisen Töne, ein Naturgedicht zwar, aber eines, das einen tiefen Einblick in die menschliche Psyche gewährt. Nach einem langen Winter weckt der aufkeimende Frühling Hoffnungs-Glück. Das alte, abgestorbene Leben, so tot es auch schien, ist nicht tot; im Frühjahr wird es wieder jung. Nicht nur Strom und Bäche sind vom Eise befreit, auch die Menschen legen ihre Eispanzer ab; wie die ersten grünen Keimlinge aus der dunklen Erde, kommen auch sie, die Menschen, aus ihren dunklen Gemäuern hervor, wo sie hustend und niesend und frierend die winterlichen Tage verbrachten: Jeder sonnt sich heute so gern! Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Der frühlingshaften Auferstehung der Natur, aufs engste verflochten mit dem Osterfest, korrespondiert die Auferstehung der Menschen: Wir mögen begraben gewesen sein, aber der Frühling läßt uns verfrorene Halbtote nach einem langen Winter auferstehen hinein in die Wärme, in die Freude, ins Glück! Und so gilt: Zufrieden jauchzet gross und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein. Endlich wieder Mensch sein dürfen: Welch eine Erleichterung! Man atmet auf, wird lebendig und leicht, und alle Welt hat Teil an diesem Jubel.
Durchaus ähnlich, und doch mit einem anderen, nämlich biblischen Akzent versehen, die Auferstehungshymne von Rio Reiser – man darf diesen Songtext nicht nur lesen, man muß ihn, gesungen von Rio Reiser mit seiner störrisch-rauen Stimme, hören, am besten sieht man dem Sänger dabei auch noch zu (dazu der Hinweis auf folgenden Youtube-Clip[2]), nur dann begreift man, was einen da ergreifen will:
Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz
Die lange Reise ist vorbei
Morgenlicht weckt meine Seele auf
Ich lebe wieder und bin frei
Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen
Die Spuren der Verzweiflung wird der Wind verweh’n
Die durstigen Lippen wird der Regen trösten
Und die längst verlor’n Geglaubten
Werden von den Toten aufersteh’n.
Ich seh die Wälder meiner Sehnsucht
Den weiten sonnengelben Strand
Der Himmel leuchtet wie Unendlichkeit
Die bösen Träume sind verbrannt.
Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen
Die Spuren der Verzweiflung wird der Wind verweh’n
Die durstigen Lippen wird der Regen trösten
Und die längst verlor’n Geglaubten
Werden von den Toten aufersteh’n.
// : //
Auch hier zunächst eine persönliche Befreiungserfahrung –: Rio Reiser und die „Scherben“, wie sich nannten, hatten das ins Polit-Dogmatische sich verhärtende linke Berliner Milieu satt und waren raus aus dem Westberliner Insel-Ghetto. Im äußersten Norden Deutschlands, in Fresenhagen, einem winzigen Dorf im Landkreis Nordfriesland nahe der dänischen Grenze, direkt am Meer gelegen, hatten sie 1975 für wenig Geld einen alten, verfallenen Bauernhof erworben. Dort machten sie jenseits der Berliner Polit-Randale ihre Musik und genossen das Leben.
Auf den ersten Blick erschöpft sich der Song, ähnlich wie das Gedicht von Goethe, im Lob auf die heilenden Kräfte der Natur: Meer, Sonne, Wind. Und so wurde dieses Lied von Kritikern in der linken Szene denn auch als unpolitischer Ausdruck der Flucht aus Kreuzberg interpretiert – raus aufs Land, nur weg von den „Bullenschweinen“ und der repressiven Gesellschaft. Tatsächlich aber wollte Rio Reiser schon vor seiner Landflucht mit dem Song ein neues Kapitel in der Geschichte der Band aufschlagen, die als gefürchtetste Musiktruppe der damaligen Bundesrepublik gehandelt wurde, als Auftragsschreiberin für die terroristische Rote Armee Fraktion (RAF), als Politrockergang für vergammelte Jungproleten. Er konnte, wie er später sagte, die Agitation und die ewigen Manifeste, die „triste linke Kleiderordnung“ und nicht zuletzt die ewige Geldnot in den dunklen Hinterhöfen der Frontstadt Berlin nicht mehr ertragen. Fresenhagen, der Wind, das Meer, die Sonne – all das ließ ihn und seine Musikerkollegen aufatmen: Endlich angekommen zu sein, wo man hingehört („Die lange Reise ist vorbei“). In biblisch anmutenden Bildern (Rio Reiser las täglich in der Bibel) erzählt das Lied vom Regen, der den Durst stillt, von der Schönheit des sonnengelben Strandes, vom Wind und vom Meer – und wie all dies ein Gefühl von Weite, Frieden und Freiheit schenkt.
Aber dann taucht da plötzlich ein anderer Gedanke auf, der das naturlyrische Ich hineinführt in die Geschichten jener, die keine Freiheit kennen, keine Ruhe erleben, keine Sonne und keinen atemschenkenden Wind. In der letzten Zeile des Refrains ist da plötzlich die Rede von den „längst verlor’n Geglaubten“, die „vom Tode aufersteh‘n.“ – Wie das? Sollte Mutter Natur über die Kraft verfügen, das Zerschlagene wieder zusammenzufügen und jenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, an denen sie, die vermeintlich liebende Mutter, selber ihre Gewalt verübt hat? (Der Tod ist ja die furchtbarste Gewalt, die uns zustoßen kann: „Du schuldest der Natur einen Tod“, heißt es in einem Brief Sigmund Freuds an seinen Kollegen Wilhelm Fließ;[3] abgesehen davon, daß nicht wenige unserer politischen Befreiungsaktionen eher einer Verdoppelung der Brutalität der Natur gleichen, denn einer wirklichen Befreiung von ihr und unseresgleichen.)Spätestens hier transzendiert Rio Reisers Lied allen Naturlyrismus und allen politischen Aktionismus jener Jahre. Wo es Rettung selbst für die noch gibt, die aus der Perspektive von Natur und Geschichte definitiv als verloren geglaubt werden müssen, da kommt eine Wirklichkeit ins Spiel, die größer ist als Natur und Geschichte. Der biblische Glaube nennt diese Wirklichkeit „Gott“. Von ihr und nicht vor allem von der romantischen Illusion einer liebenden, in der Wärme der Frühlingssonne uns umarmenden „Mutter Natur“, handelt Rio Reisers Auferstehungshymne. Und so ist diese trotzig-anarchische Hymne nun wirklich ein Osterlied in des Wortes echtestem Sinn. Von dieser Wirklichkeit etwas zu erfahren, das wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben von ganzem Herzen. Ein gesegnetes Osterfest!
Joachim Negel
Dekan
[1] Faust. Der Tragödie Erster Teil, 5. Szene („Vor dem Tore“), Vers 1064 – 1125.
[2] Rio Reiser, „Land in Sicht“ (LP „Wenn die Nacht am tiefsten“, Indigo Musikproduktion + Vertrieb GmbH, 1975). Eine leicht zugängliche Version findet sich unter https://www.youtube.com/watch?v=mTUIsKRFVAE
[3] Brief an Wilhelm Fließ Nr. 104 vom 6. Februar 1899, in: Sigmund Freud: Aus den Anfängen der Psychoanalyse 1887-1902, Frankfurt a.M. 1962, 237.