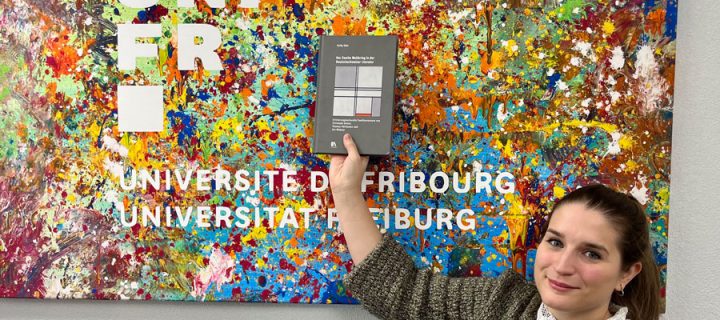Erinnerungskulturelle Familienromane sind ein gutes Medium, um gesellschaftliche und historische Themen zu vermitteln. Germanistin Emily Eder zeigt in ihrem Buch auf, welches Bild von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg in der zeitgenössischen Deutschschweizer Literatur gezeichnet wird.
«Es wird hinterfragt, infrage gestellt. Kann das wirklich so gewesen sein? Wie kann es sein, dass die offizielle Darstellung nicht mit dem übereinstimmt, was sie erlebt haben?» So beschreibt Emily Eder die Herangehensweise der drei Autoren Christoph Geiser, Thomas Hürlimann und Urs Widmer, deren Werke sie für ihre Dissertation analysiert hat. Sie setzte sich mit der Frage auseinander, wie in erinnerungskulturellen Familienromanen die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg dargestellt wird.
«In Deutschland und in Österreich ist das ein grosses Forschungsfeld. Viele Autor_innen haben über das geschrieben, was sie an Unterlagen bei ihren Eltern und Grosseltern auf dem Dachboden gefunden haben. Es gibt daher sehr oft einen autobiografischen Bezug. Das hat mich neugierig gemacht zu schauen, wie es in der Schweiz aussieht», erklärt die in Köln aufgewachsene Eder, wie sie auf die Idee für das Thema kam. Denn die Schweiz stellte im Kontext dieser Forschung einen blinden Fleck dar. «Also habe ich angefangen, viel zu lesen und dabei festgestellt, dass der Zweite Weltkrieg auch in der Deutschschweizer Literatur ein Thema ist. Es ist letztendlich nicht überraschend, denn weder die Schweiz noch ihre Literatur sind losgelöst vom europäischen Kontext.»
Besonders interessant sind Geiser, Hürlimann und Widmer vor dem Hintergrund, dass ihre Werke mehrheitlich in die Zeit fallen, in der das Narrativ vom heroischen Widerstand, das die offizielle Schweiz lange Zeit aufrechterhielt, zu bröckeln begann. Eine Zeit, in der die 1996 vom Bundesrat eingesetzte «Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg» genauer hinschaute.
Kritik in verschiedenen Formen
Welches Bild der Schweiz zeichnen Geiser, Hürlimann und Widmer? «Kein einheitliches. Aber alle hinterfragen auf ihre eigene Art, in ihrem spezifischen Kontext, das Narrativ vom heroischen Widerstand.». Urs Widmer etwa beschreibt im 2004 erschienenen Roman «Das Buch des Vaters» aus der Perspektive eines Kindes – es handelt sich dabei um ihn selbst als kleinen Jungen –, wie sein Vater eingezogen wurde und wie er die Réduit-Strategie wahrgenommen hat. «Es ist alles literarisiert und fiktionalisiert, entsprechend schwierig ist zu beurteilen, wie weit sich die geschilderte Szene wirklich so abgespielt hat», sagt Eder. «Aber die Kritik wird in einer besonders eindrucksvollen Passage deutlich, weil nicht klar wird, ob der erzählende Sohn die Gedanken des Vaters wiedergibt oder ob er selbst diese kommentiert. Beide Lesarten sind möglich. Er stellt sinngemäss die Fragen: Wie hätten die Soldaten im Réduit die Schweiz verteidigen können? Und was sollte dann mit allen anderen Personen in der Schweiz geschehen?»
Thomas Hürlimann, der selbst entfernt jüdische Vorfahren hat, zeigt seinerseits wiederholt auf, wie jüdisches Leben in der Schweiz aussah. Etwa im 2006 erschienen Roman «Vierzig Rosen». «Dort gibt es das Tagebuch der Mutterfigur, das zumindest an das Tagebuch von Anne Frank erinnert, wenn nicht daran angelehnt ist. Es wird dargestellt, dass jüdische Menschen von der Schweizer Bevölkerung teilweise feindlich behandelt wurden.»
Christoph Geiser wiederum setzt sich in erster Linie kritisch mit der bürgerlichen Schicht auseinander. «Wichtiger Bezugspunkt ist sein Grossvater Hans Frölicher, der während des Zweiten Weltkriegs Diplomat in Berlin war und von der offiziellen Schweiz später als Sündenbock dargestellt wurde, weil er die Schweiz aus eigenem Antrieb zu deutschlandfreundlich vertreten habe. Vereinfacht müsste man rückblickend sagen, ihn als Sündenbock zu instrumentalisieren ist sicher nicht richtig, ein vorbildlicher Diplomat war er jedoch auch nicht.» Geiser kannte seinen Grossvater, und auch die Dokumente, die er von seiner Mutter erhielt, zeichneten ein differenziertes Bild. «Das ist etwas, was alle drei Autoren machen: Sie stellen dem historischen Ganzen ein Privatleben gegenüber, geben Einblicke in Alltagssituationen. Sie ergänzen somit die historische Perspektive.»
Der Familienroman hat mehrere Stärken
Das ist für Emily Eder genau die Stärke des Familienromans, wenn es um die Vermittlung relevanter gesellschaftlicher und historischer Themen geht. «Wir alle stecken in einem familiären Beziehungsgeflecht. Entsprechend haben wir Anhaltspunkte, um an das anzuknüpfen, was uns literarisch vermittelt wird. Dadurch können wir diese Fragen womöglich innerhalb unserer eigenen Familie stellen – bei mir war das der Fall», sagt Eder. «In der Familie kann über verschiedene Generationen Erlebtes weitergegeben werden – oder eben gerade nicht. Es kann Tabus geben, fehlende Kommunikation, sodass wir erst nach dem Tod der Eltern oder Grosseltern merken, warum Beziehungen dysfunktional waren. Deshalb sind die Familienromane, gerade wenn sie einen autobiografischen Gehalt haben, sehr aufschlussreich.»
Die drei Autoren nehmen stellenweise die Perspektive ihrer Eltern ein, versuchen, sich in sie hineinzuversetzen, zeigen oft aber auch Generationenkonflikte auf. «Das ist das Potenzial von Literatur. Sie ist ein Medium, das uns erlaubt, etwas über andere Menschen zu lernen. Darüber, was es heisst, überhaupt Mensch zu sein, weil wir in die Gedanken von anderen Menschen schlüpfen können. Aber auch, um in der Zeit zurückzugehen und Einblicke in andere politische Systeme und historische Momente zu erhalten. Das können andere Medien zwar auch, aber über die Literatur verläuft die Auseinandersetzung viel langsamer und persönlicher.»
Der Einfluss von Literatur als Spiegel der Gesellschaft
Wie gross also ist der Einfluss von Literatur auf die Wahrnehmung eines bestimmten Themas in der Gesellschaft? Auf die Geschichtsschreibung oder Geschichtsumschreibung? «Das hängt immer auch davon ab, wie und von wem die Literatur rezipiert wird. Meiner Ansicht nach könnte der Einfluss grösser sein – aber das scheint eine der Herausforderungen der Geisteswissenschaften zu sein.» Emily Eder will ihren Teil dazu beitragen, den gesellschaftlichen Dialog durch Literatur und die Forschung darüber anzukurbeln. Auch deshalb hat sie die Möglichkeit genutzt, ihre Dissertation mit SNF-Geldern als Buch zu publizieren. Nicht ohne Stolz hat sie es vor kurzem in einer grossen Buchhandlung in Bern entdeckt. «Es wird kein Bestseller werden, die meisten Leute lesen vor dem Einschlafen keine Dissertationen», sagt Emily Eder mit einem Schmunzeln. «Aber vielleicht kann ich ein wenig Neugier wecken, womöglich liest jemand Bücher dieser Autoren plötzlich mit einer anderen Brille und macht sich zusätzliche Gedanken. Das wäre bereits ein Gewinn.»
Dr. Emily Eder hat Germanistik, französische Sprache und Literatur sowie Komparatistik an den Universitäten Freiburg und Köln studiert. Heute arbeitet sie als Studiengangskoordinatorin und pädagogische Beraterin in der Abteilung Medizin an der Universität Freiburg. Literatur nimmt in ihrem Leben immer noch einen wichtigen Platz ein, man trifft sie beispielsweise beim Literaturprogramm im Kino Korso.
Das 232-seitige Buch «Der Zweite Weltkrieg in der Deutschschweizer Literatur – Erinnerungskulturelle Familienromane von Christoph Geiser, Thomas Hürlimann und Urs Widmer» ist 2024 im Chronos Verlag erschienen.
__________- E-Book (pdf) kostenlos herunterladen